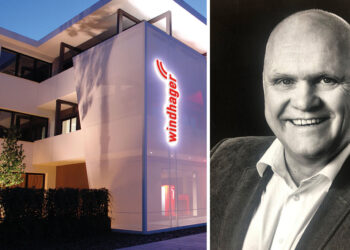Georg Patay bleibt auch als aktiver Pensionist der SHK-Branche verbunden und kommentiert mit seiner mehr als 30jährigen HLK-Expertise in unterschiedlichen Managementfunktionen und Verbänden exklusiv für SHK-AKTUELL unterschiedliche Haustechnikthemen aus seinem Blickwinkel.
Um beim öffentlichen Verkehr einen schnelleren Personentransfer an Haltestellen zu gewährleisten, müssen Fahrgäste zuerst aussteigen und dann einsteigen. Diese Regel garantiert einen effizienten Ablauf. Bei der Transformation im Energiesektor ist es jedoch genau umgekehrt: Erst wenn das neue System aufgebaut und funktionsfähig ist, darf das alte abgeschaltet werden. Nach dem Prinzip: trotz Umbau sichere Energieversorgung. Daher wäre es grob fahrlässig, fossile Kraftwerke für Strom- und Fernwärmeerzeugung voreilig abzuschalten, bevor neue erneuerbare Kraftwerke samt notwendiger Infrastruktur vollständig installiert sind. Denn als temporärer „Überbrücker“ sind diese Technologien und Energieträger für eine verlässliche Energieversorgung unserer Wirtschaft unerlässlich.
Statt Monokulturen Diversität
Bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung ist Vielfalt seit Jahren gelebte Praxis. So besteht die Stromproduktion in Österreich aus einem bunten Mix aus Wasserkraft, Photovoltaik, Windenergie, zukünftig auch Wasserstoff bzw. Grüngasen, kalorischen Kraftwerken und Stromimporten. Bei der Fernwärme ist es ähnlich: Hier kommen Biomasse, Solarenergie, Wärmepumpen, Abwärme (z. B. aus Müllverbrennung oder Industrie), Geothermie sowie Erd- und Biogas zum Einsatz. Je nach Tages- oder Jahreszeit schwankt der Anteil der jeweiligen Energieträger. Im Jahresschnitt liegt in Österreich der erneuerbare Anteil bei Strom bereits bei > 83 %, bei Fernwärme bei etwa 50 % (KELAG Energie & Wärme > 70%), bei Gas bei rund 2 %. Was bei leitungsgebundenen Energieträgern selbstverständlich ist – eine Kombination aus Technologie und Energieträgern – sollte auch für individuelle Heizsysteme gelten.
Konsumenten wollen sanfte Übergänge
Gerade im Bestandsmarkt lassen sich Kunden nicht von heute auf morgen auf neue Technologien oder Energieträger ein. Ein positives Beispiel zeigt die Automobilbranche: Mit Hybridfahrzeugen lernen Konsumenten die Vorteile der Elektromobilität kennen, ohne auf Reichweite und schnelle Betankung von Verbrennern verzichten zu müssen. Die aktuellen Pkw-Neuzulassungen sprechen eine klare Sprache: Im 1. Halbjahr 2025 wurden deutlich mehr Hybridfahrzeuge zugelassen als reine Elektroautos oder Verbrenner. Das zeigt: Kunden wollen Flexibilität und einen sanften Übergang. Dieses Prinzip, das in der Energiewirtschaft seit Jahren gilt und bei Autos bereits etabliert ist, muss nun auch auf die Heizungsbranche übertragen werden.
Mehr Hybrid, weniger Ideologie
Fast alle namhaften Hersteller bieten bereits heute Gasgeräte an die mit H2-angereichertem Erd- oder Biogas problemlos betrieben werden können. Bosch bringt erstmals ein Gasgerät auf den Markt, das dank integrierter Hydraulik auch nachträglich mit einer Wärmepumpe leicht kombiniert werden kann. Sehr vielversprechend sind auch Anergienetze in Kombination mit dezentralen, kleinen Wärmepumpen in Wohnungen – beispielsweise das Konzept von Qvantum. Diese hybriden Lösungen können mit unterschiedlichen Energiequellen wie Tiefenbohrungen, Erdkollektoren, Latentspeichern, thermischer Nutzung von Abwasser oder Abwärme kombiniert und sowohl für Heizung als auch Kühlung eingesetzt werden.
Entlastung statt Überlastung
Gerade in Zeiten von Dunkelflauten ist der reine „All-Electric-Ansatz“ riskant. Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge brauchen auch dann Strom, wenn Photovoltaik und Wind wenig liefern. Hybridsysteme wirken hier wie ein Puffer: Sie können u.a. auf lokal gespeicherte Energie (Batterien, Wärme) oder auf biogene Brennstoffe zurückgreifen. Wer auf Hybrid setzt, entlastet die Infrastruktur und stärkt die Versorgungssicherheit.
Fazit
Hybrid bedeutet: mehrere Energieträger und Technologien intelligent kombinieren. Das sorgt nicht nur für Unabhängigkeit von Preisschwankungen und Lieferengpässen, sondern auch für echte Resilienz. Wer Hybrid fördert, stärkt Netz- und Preisstabilität und gewinnt wertvolle Zeit für den nötigen Ausbau der überlasteten Strominfrastruktur. Wer dies ignoriert, schadet der Umwelt und verzögert die Energiewende.